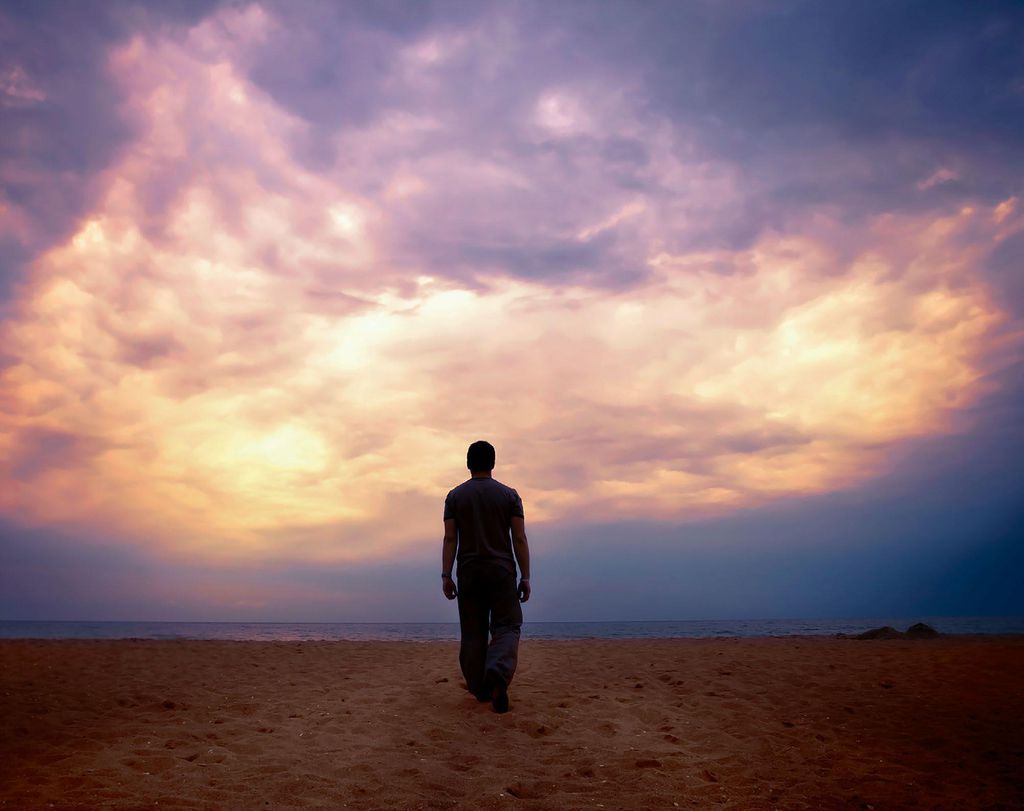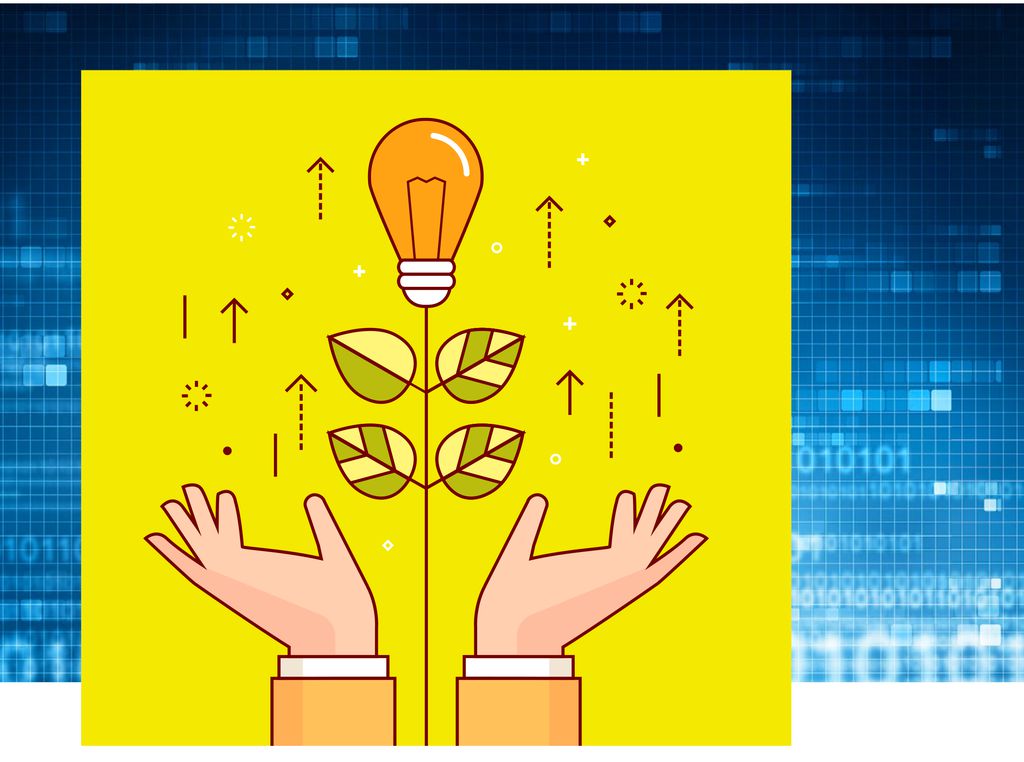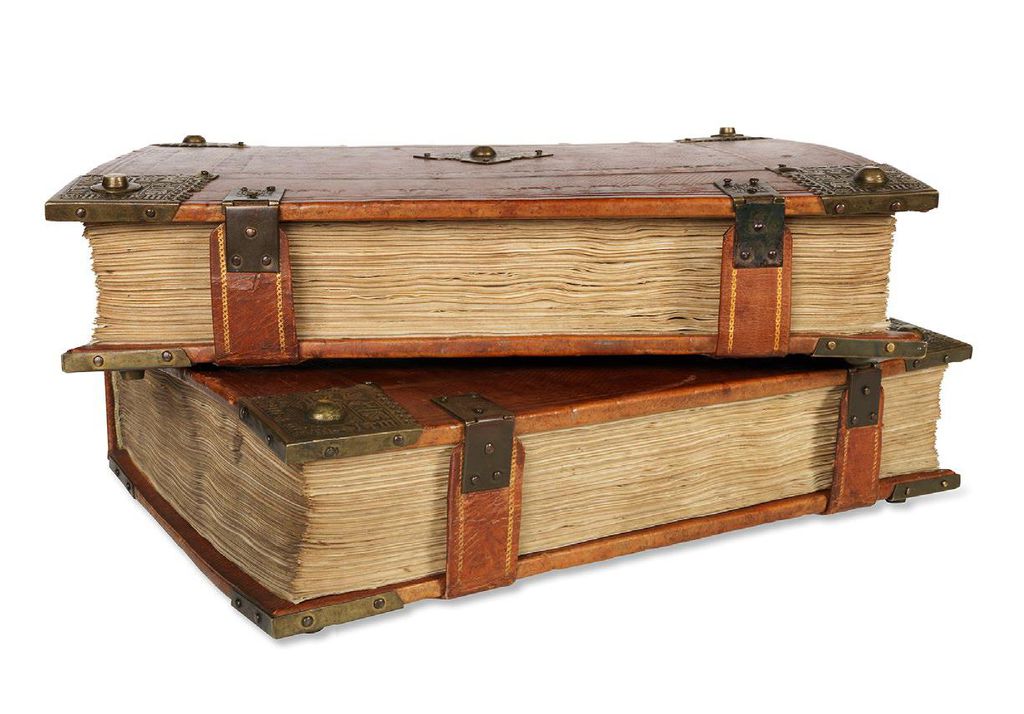EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser
«Das grundlegendste Menschenrecht ist das Recht auf Leben. Ohne dieses Recht kann kein anderes Menschenrecht in Anspruch genommen werden.» Das sind mal zwei Sätze, die stimmen. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Im Lichte dieser im Grunde einfachen, aber richtigen und weisen Erkenntnis klären sich viele ethische Fragestellungen. Es ist nicht so kompliziert: Wer das grundlegendste Menschenrecht angreift, das Recht auf Leben, greift auch jedes andere Menschenrecht an. Auf der Basis dieser Erkenntnis sollten Sachverhalte bewertet und politische Entscheidungen getroffen werden. Es ist töricht, das nicht zu tun. Ich stiess auf diesen Merksatz bei der «Aktion Lebensrecht für Alle» (ALfA), die sich für das Recht auf Leben aller Menschen einsetzt, auch der Schwachen, der Behinderten und der Schwächsten: der noch Ungeborenen.
In der Bibel ist mehrfach zu lesen, dass über törichte Menschen – das sind Menschen, die Gott für ein Märchen halten – das kommt, wovor sie sich fürchten. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass wir derzeit Zeugen dessen sind. Ängste dominieren das Leben vieler Menschen. Angst vor einer Klima- und Seuchen-Apokalypse. Eigentlich ist es eine Angst vor dem Leben. Der amerikanische Pastor Jonathan Brentner sagte: «Wir sind zu einer ängstlichen Bevölkerung geworden, die sich so sehr vor dem Sterben fürchtet, dass sie aufgehört hat, zu leben oder das Leben zu geniessen.»
Wer auf Gott vertraut, braucht sich nicht zu fürchten.
Aus einem Lied von Hella Heizmann
Angst ist auch ein Instrument der Politik. Seit jeher wird Angst von gottlosen Politikern als Mittel eingesetzt, um Menschen gefügig zu machen. Das funktioniert am besten bei Menschen, die so gottlos sind wie ihre Regenten. Es gibt ein hartes Wort: Jedes Volk hat die Regierung, die es verdient. Der «Spiegel» bezeichnete auf dem Titelblatt Masken als «unsere einzige Hoffnung». Stofflappen, unsere «einzige Hoffnung»? Das ist mehr als eine Aussage, die für ein bestimmtes Problem eine Lösung präsentieren will. Darin offenbart sich vielmehr die ganze Armseligkeit des Diskurses über diese Krankheit. Mehr noch: das Verhängnis, in das die Angst und die Reaktion auf eine Krankheit die Menschen führt. Es wird geschätzt, dass 40 Millionen Amerikaner obdachlos werden. In anderen Regionen, etwa Südamerika oder Indien, ist die Situation noch schlimmer. Menschen verhungern, sie sterben an den Corona-Massnahmen.
In den wenigsten Ländern der Welt wartet auf diese Menschen eine bequeme soziale Hängematte. Und auch die soziale Sicherheit in unseren Ländern ist eine Illusion. Jeder Cent, der ausgegeben wird, muss schliesslich von jemandem erwirtschaftet worden sein. Wer den Versprechen der Politiker vertraut, – die ja kein Geld erwirtschaften, sondern Geld kosten –, ist schlecht beraten. Ins Elend gestürzt werden Menschen auch, weil sie isoliert von anderen Menschen sind und aus der Einsamkeit nicht mehr herausfinden; weil ihr ganzes Denken von den Sorgen um ihre Zukunft gefangen genommen worden ist. Die Maske ist das Symbol dieses Denkens und dieser Politik. Was wird bald – sicher dann auch auf dem «Spiegel»-Titelblatt – als Erlösung aus diesem Tal der Trübsal präsentiert werden? Es wird mehr als eine Maske sein.
«Wer auf Gott vertraut», erklingt es in einem schönen Lied, «braucht sich nicht zu fürchten, vor dem Dunkel der Nacht und der Einsamkeit». Auch nicht vor der Einsamkeit, die Christen befallen mag, wenn das Dunkel zunimmt, wenn die Gottesferne der Mächtigen und der einfachen Menschen die Gläubigen zu Sonderlingen macht. Das ist ganz normal, dass Christen «nicht mehr mitspielen dürfen», dass sie im Weg stehen, wenn Christus den Menschen zum Ärgernis wird. Die Hoffnung aus der Heiligen Schrift ist eine lebendige Hoffnung. Wer in ihrem Lichte lebt, dessen Seele wird auch im aufkommenden Dunkel sein «wie ein bewässerter Garten» (vgl. Jes. 58,11). Also lassen wir das Sorgen und weisen auf den hin, der das Licht ist und die Wahrheit, Jesus.