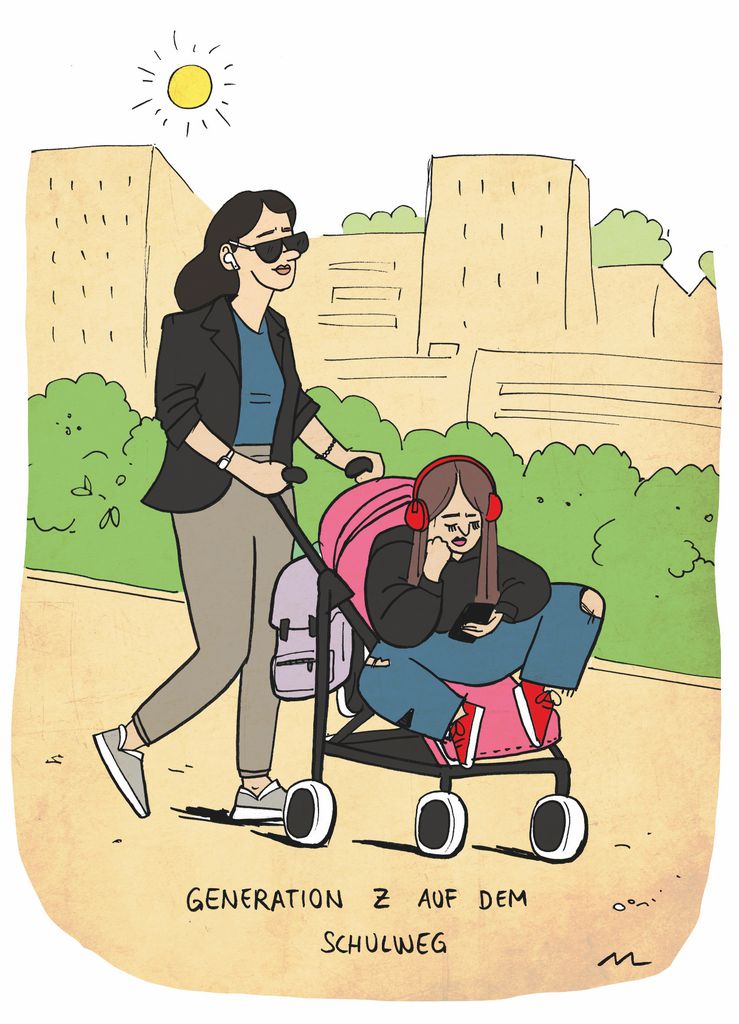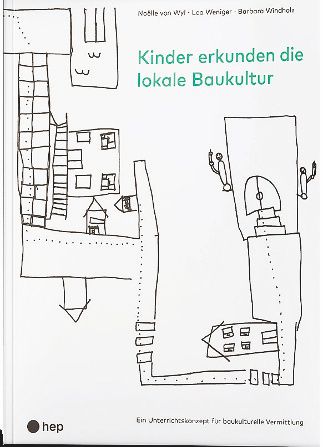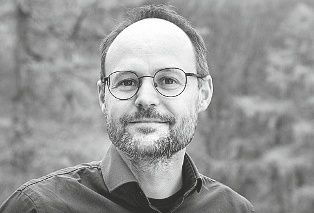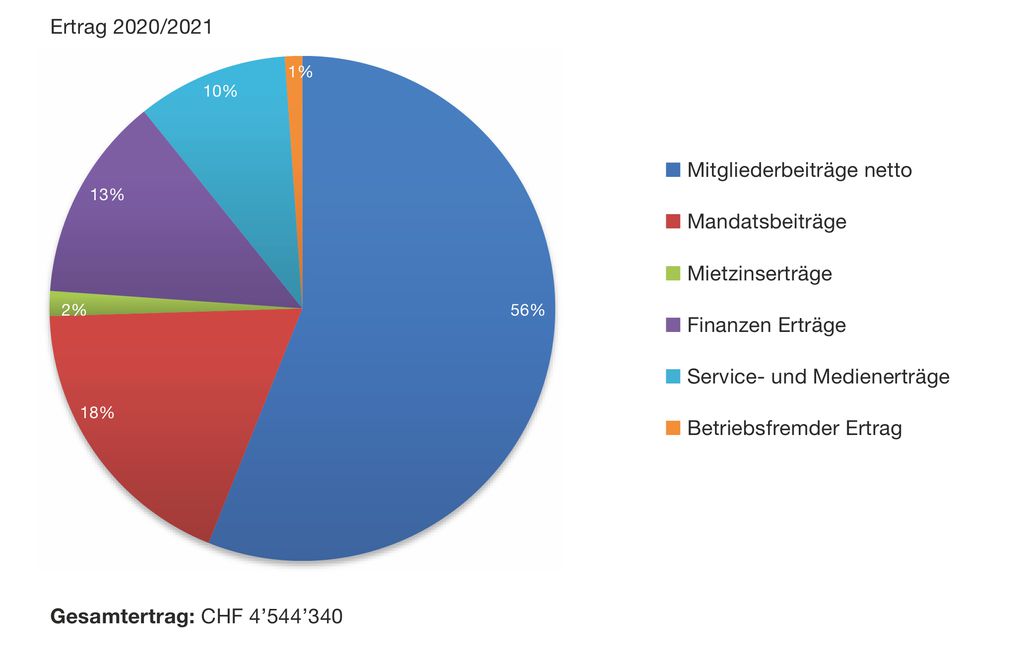«Der Generation Z fehlt der Wille, dranzubleiben»
Antje-Britta Mörstedt berät Firmen, wie sie junge Menschen in ihre Teams integrieren können. Die sogenannte Generation Z wolle unterhalten werden, sagt die Betriebswirtschafterin. Das hat auch Auswirkungen auf die Schule.
Interview: Christoph Aebischer
Fotos: Marc Renaud
BILDUNG SCHWEIZ: Ein guter Ausbildner müsse für die Generation Z ein Coach mit Entertainerqualität sein, schreiben Sie. Wieso?
ANTJE-BRITTA MÖRSTEDT: Diese jungen Menschen sind in Familien aufgewachsen, in denen Mutter und Vater auf Augenhöhe kommunizieren. Auch im Internet, das sie sehr rege nutzen, gibt es keine Hierarchie. Ich erreiche berühmte Leute direkt über Instagram oder Mes-senger-Dienste. Ich kann mich sogar mit Barack Obama austauschen, falls er nicht andere mit der Betreuung seiner Social-Media-Kanäle beauftragt hat. Die Jugend ist sich also ausgeglichene Verhältnisse gewohnt. Darum ist es wichtig, dass sie wie in einem Coaching behandelt werden.
«Karriere um jeden Preis wird man mit der Generation Z nicht machen können.»
Coach geht ja noch, aber Entertainer?
Ein Blick auf die sozialen Medien zeigt, wie schnelllebig Unterhaltung geworden ist. Die grossen Techfirmen buhlen um Aufmerksamkeit. Wir haben ein paar Sekunden, um die Aufmerksamkeit der jungen Leute zu erhaschen, und deshalb sind auch Entertainmentqualitäten wichtig.
Die jungen Menschen werden zuweilen als materialistische Monster bezeichnet. Ist das nicht ein gar hartes Urteil?
Ich sage das nicht. Das ist ein Zitat aus Studien. Ich sehe das differenzierter. Fridays for Future oder Bewegungen, für die Nachhaltigkeit zentral sind, sind bestimmt nicht materialistisch. Doch es gibt eben auch den Trend der Fast Fashion, der schnellen Moden: also Kleider schnell auszutauschen und damit nicht nachhaltig zu sein. Unter den jungen Leuten, die ab Mitte der 90er-Jahre bis ungefähr 2010 geboren wurden, gibt es vielfältige Strömungen, wie in jeder Generation.
Was sehen Sie in ihnen?
Viele unter ihnen machen sich sehr viele Gedanken. Angst ist aber auch stark verbreitet. Gerade die Pandemie oder die instabile politische Lage verunsichert junge Leute. Sie fürchten sich davor, irreversible Entscheidungen zu treffen. Das wirkt sich zum Beispiel auf die Berufswahl aus. Sie bleiben unentschlossen. Hinzu kommt oft die fehlende Ausdauer. Sie geben schnell einmal eine Ausbildung auf oder sagen, das schaffe ich nicht. Fehlschläge gehen tiefer. Und danach fehlt der Kampfwille, den die Generation davor noch hatte.

Sie geraten rascher aus der Spur?
Ich meine damit nicht, dass sie jeglichen Halt verlieren. Aber es fehlt der Wille, um dranzubleiben. Sie können mit Rückschlägen weniger gut umgehen.
Ist das mit dem «No Future»-Gefühl junger Menschen in den 90er-Jahren vergleichbar?
Das nicht. Für die Generation Z zählt das Privatleben stärker. Sie verstehen den für uns wichtigen Begriff der Work-Life-Balance gar nicht. Sie verstehen nicht, wenn Leute stöhnen beim Arbeiten. Sie wollen beim Arbeiten auch leben. Karriere um jeden Preis wird man mit denen nicht machen können. Eine Karriere bleibt für viele dennoch ein erstrebenswertes Ziel – allerdings ohne 70-Stunden-Woche.
Sie raten, sich mit den Eigenheiten dieser Generation zu befassen. Weshalb?
In Unternehmen handeln Führungskräfte teilweise immer noch so wie früher. Ich mache ein Beispiel: Wer vom Chef nichts hört, hat wohl gute Arbeit geleistet. Nichts gesagt war früher gelobt. Jetzt haben sie plötzlich Angestellte, die von Bewertungsbuttons darauf getrimmt sind, täglich ein persönliches Feedback zu erhalten. Nun müssen Chefs ihr Feedback- und Führungsverhalten anpassen. Darum ist es wichtig, zu wissen, wie die Jungen ticken. Aber noch viel wichtiger sind Generationentrainings, in denen die Jungen lernen, wie die Alten ticken.
Worauf müssen sich alteingesessene Lehrerinnen und Lehrer einstellen, wenn junge Lehrpersonen hinzukommen?
Wer viel Berufserfahrung hat, neigt manchmal dazu, seine Methoden als die einzig richtigen zu sehen. Gerade in diesem Beruf sollte man aber nicht auf herkömmliche Instrumente bestehen. Statt zu bremsen sollten Alteingesessene Junge dazu ermutigen, Neues auszuprobieren. Davon können auch sie profitieren.
Die Generation Z sitzt auch im Schulzimmer. Was ist dort angezeigt?
Man muss die Schülerinnen und Schüler bei Laune behalten, indem sie aktiv in den Unterricht eingebunden werden und das Internet miteinbezogen wird. Jeder zweite Jugendliche lernt mit Youtube. Also kommt das wahrscheinlich auch in der Schule gut an. Von oben herab zu dozieren, ist sowieso out. Der Lehrer ist heute ein Experte unter vielen. Was er sagt, lässt sich ruckzuck mit Google überprüfen.
Lehrpersonen werden zu Unterhaltern?
Um Gottes willen kein Anbiedern. Das war von jeher schlecht. Ich bin selber Dozentin und nicht ausgebildete Lehrerin. Doch das gilt wohl für beide: In Jugendsprache zu verfallen etwa, halte ich für sehr kontraproduktiv. Auch wer auf Augenhöhe kommuniziert, muss eine gesunde Distanz wahren.
Aktuell ist es die Generation Z. Aber schauten Erwachsene nicht schon immer mit Unverständnis auf die Jungen?
Alte lästern über Junge. Das war tatsächlich schon immer so.
Ist diese Generationen-Etikettierung darum nicht grundsätzlich eine ambivalente Sache?
Das stimmt. Wir sollten sehr vorsichtig sein, alle in dieselbe Schublade zu stecken. Denn jede Generation zeigt eine breite Streuung. Zudem widersprechen sich Studien auch immer wieder. Stereotype helfen also nicht weiter. Bei Begegnungen müssen wir darum stets schauen, wer genau vor uns steht.
Zudem werden Junge älter und verändern sich.
So ist es. Die Generation Z bleibt nicht so, wie sie heute ist. Wer heiratet oder Kinder kriegt, wandelt sich.
Wenn eine Generation kein einheitliches Bild abgibt, was bringt die Generationenforschung dann überhaupt?
Ich kann da für jenen Bereich antworten, in dem ich tätig bin. Unternehmen interessiert, wie sie die Jugend als Arbeitskräfte gewinnen können und wie sie mit ihnen umgehen sollen. Das beginnt mit der Stellenanzeige. Junge erreichen sie nicht mit einem klassischen Zeitungsinserat. Da muss eine Website zum Beispiel viel eher die sinnstiftende Tätigkeit in den Vordergrund stellen. Sind sie einmal eingestellt, wollen sie auf Augenhöhe geführt werden. Es kann passieren, dass eine junge Angestellte ins Büro platzt und den Vorstand fragt: Was machen Sie denn den ganzen Tag? Und sie meint es gar nicht vorlaut.
«Jeder zweite Jugendliche lernt heute mit Youtube. Also kommt das wahrscheinlich auch in der Schule gut an.»
Junge wollen ein angenehmes Privatleben neben der Arbeit. Ich habe 8500 junge Menschen befragt. Dabei ist herausgekommen, dass ihre Erwartungen an den Arbeitgeber ziemlich hoch sind. Am Wochenende zu arbeiten, nur weil der Chef das möchte, das ist nicht mehr selbstverständlich. Bevor Sonderleistungen erbracht werden, wollen sie heute wissen, was sie als Ausgleich erwarten können.

Wo orten Sie die Ursachen für diese Muster?
Die junge Generation wurde anders erzogen. Gesellschaftliche Werte haben sich geändert. Früher galt, ein Klaps auf den Hintern schadet nicht. Das ist vorbei. Aber auch Ereignisse wie die Wirtschafts- und Finanzkrise, der arabische Frühling oder die komplexe, hochvolatile, unsichere Geschäftswelt beeinflussen die Jugend. Zudem ist die Generation Z mit dem Internet gross geworden. Das alles prägt.
Was haben «Kampfhelikoptereltern» – offenbar die Steigerungsform von Helikoptereltern – damit zu tun?
Mit diesem Begriff sind Eltern gemeint, die wegen allem in die Schule rennen. Sie bringen dort vor, ihr Kind sei hochbegabt oder dieses und jenes. Das sind Eltern, die weinen, wenn ihre Kinder ausziehen und die dann am Leeren-Nest-Syndrom leiden und angeblich nicht mehr wissen, was sie mit ihrem Leben anstellen sollen.
Sie haben ihre Kinder verwöhnt?
Nicht alle. Es gibt auch heute arme Familien. Meine Schilderung trifft eher auf mittelständische und gut situierte Eltern zu. Sie fahren ihre Kinder in die Schule, manche begleiten sie sogar ins Klassenzimmer oder veranstalten Kindergeburtstage wie kleine Hochzeiten. All das verändert Kinder.
Das tönt wie ein Menetekel. Ich frage mal andersrum: Was wird besser mit diesen jungen Menschen?
Ich hoffe, dass sie unsere Gesellschaft voranbringen: Sie werden Hierarchien einebnen und die Arbeitswelt transparenter und offener machen. Der Gedanke, dass ich auch bei der Arbeit lebe, wird wichtiger. Sie betreiben in eigener Sache eine Art Gesundheitsmanagement und achten stärker auf ihre Gesundheit. Die Unternehmenskultur wird nachhaltiger. Wir müssen hier festhalten: Der Fachkräftemangel verlangt auch, dass wir uns um diese Jungen bemühen, damit möglichst alle den Einstieg ins Arbeitsleben schaffen.
Zur Person
An der diesjährigen Delegiertenversammlung des Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH) hielt Antje-Britta Mörstedt (56) ein Referat zur Generation Z. Die Betriebswirtschafterin ist Professorin an der PFH Private Hochschule Göttingen in Deutschland. Mörstedt berät regelmässig Unternehmen in Rekrutierungs- und Personalfragen. Seit März 2015 ist Mörstedt Vizepräsidentin der PFH für Fernstudium und Digitalisierung. Sie ist Mutter dreier Kinder im Alter der Generation Z.